Ballensilagen - Silieren im Kleinformat
Bei der Haltbarmachung des Futters in Rund- oder Querballen kommt es auf eine gute Pressarbeit, auf ein sachgemäßes und möglichst unverzügliches Einwickeln und auf einem schonenden Umgang beim Transport bis zur endgültigen Lagerstätte an. Doch nicht nur technische Aspekte sind maßgebend für die Güte der silierten und mit Folie eingehüllten Ware, sondern auch der Zustand des Futters auf dem Feld sowie die Welk- und Erntebedingungen.
Worauf beim Silierverfahren des Weiteren zu achten ist, wird nachfolgend beschrieben.
Vor- und Nachteile der Rundballenbereitung
Aufgrund der geringen Flächenleistung wird die Silagebereitung von Gras in Rundballen häufig dann praktiziert, wenn es gilt, kleine Erntemengen zu bergen. Das Silierverfahren findet demzufolge oft für Sommeraufwüchse seine Anwendung. Darüber hinaus ermöglicht die Rundballenbereitung auch eine separate Mahd von unterschiedlich schnittreifen Grasbeständen.
Insbesondere für kleinere Betriebe kann es von Vorteil sein, den Tieren das Futter in kleinen, separat abgepackten Portionen anzubieten. Doch jeder Rundballen birgt seine eigene Qualität im Hinblick auf den Nährstoffwert, den Energiegehalt und die Gärqualität. Das kann für Hochleistungsherden von Nachteil sein, denn für ein leistungsgerechtes Füttern sind möglichst einheitliche Gebrauchswerteigenschaften des Futters grundlegend. Als weiterer Nachteil ist bei diesem Verfahren zudem der hohe Anteil an Folienabfall zu benennen.

Aus der Praxis hört man oft die Frage, ob die Silagequalität im Fahrsilo besser zu bewerten ist als in Rundballen. Was den Futterwert anbelangt, muss es nicht zwangsweise zu Unterschieden in der Grassilagequalität zwischen den beiden Verfahren kommen. Für beide Fälle ist vorrangig der Schnittzeitpunkt maßgebend. Allerdings sollten die Trockenmassegehalte für die Silagebereitung in Rundballen höher sein und in dem Bereich zwischen 40 und maximal 50 % liegen. Vor dem Hintergrund werden gute Anwelkbedingungen benötigt.
Aufgrund der hohen Trockenmassegehalte des Futters stellt sich auch die Konservierung anders dar als im Fahrsilo.
Konservierungsprinzip
In einem gut mit Folie eingehülltem Rund- oder Querballen wird das Gärheu in aller Regel durch drei Konservierungsverfahren haltbar gemacht:
- durch das hohe Anwelken (Trocknung),
- durch Säurebildung (pH-Wertabnahme)
- und durch eine gewisse Kohlendioxidatmosphäre.
Kohlendioxid wirkt insbesondere auf Schimmelpilze keimhemmend.
Die Säurebildung und pH-Wertabnahme lassen sich im Rundballen zwar auch nachweisen, doch die Gehalte an Gärsäuren sind infolge des hohen Welkgrades sehr gering. Folglich kommt der Säuerung nur ein kleiner Anteil zur Hemmung von Gärungsschädlingen zu.
Durch das Anwelken erhöht sich der osmotische Druck. Damit werden mikrobiologische Aktivitäten stark reduziert. Vor dem Hintergrund ist auf ein gleichmäßiges Anwelken großer Wert zu legen und ein TM-Niveau in dem Bereich zwischen etwa 40 – maximal 50 % anzustreben.
Damit auch die Schimmelbildung unterbunden wird, sollte das Kohlendioxid als Gärgas möglichst lange im Ballen verweilen.
Für gut konservierte Rundballen sind somit eine gute Siliertechnik und eine ordnungsgemäße Lagerung von hoher Bedeutung.
Siliertechnische Tipps
Zunächst sind für die Rundballen hohe Lagerungsdichten anzustreben. Je geringer das Porenvolumen ist, desto rascher kann der Porenraum mit Gärgasen umströmt und mikrobielle Aktivität reduziert werden. Die mechanische Verdichtungsarbeit der Presse wird mit den drei, nachfolgend benannten Maßnahmen unterstützt:
- Durch das Anwelken auf die o.g. Trockenmassegehalte bis 50 %. Ein starkes Überschreiten des Anwelkgrades ist zu vermeiden, denn damit nimmt die Trockenmassedichte im Ballen wieder ab.
- Durch einen gleichmäßigen Massestrom von der Pick bis zur Presskammer. Vor dem Hintergrund ist ein gleichmäßig geformtes Schwad gleichfalls von Bedeutung. Die Arbeitsbreite des Schwaders sowie Größe und Form der Schwade sind an die Aufnahmetechnik anzupassen. Gegebenenfalls sollte dem Lohnunternehmer die Aufgabe des Schwadens anvertraut werden. Damit wäre neben einer optimalen Abstimmung der Technik auch eine zügigere Beerntung möglich.
- Durch das Nutzen der gesamten Schneidwerkkapazität der Presse. Mit dem Zerkleinern des Futters lässt sich der Verdichtungsgrad um 6 % bis 12 % erhöhen. Auch das spätere Auflösen des Ballens wird durch das Nutzen des Schneidwerkes erleichtert und mindert den Kraft- und Zeitaufwand.
Neben den oben genannten Punkten beeinflusst das Bindungsverfahren ebenfalls die Pressleistung. Hierbei hat sich vor allem die Netzbindung aufgrund ihrer besseren Leistung gegenüber der Kunststoffgarnbindung bewährt. Ein neuer Trend ist die Bindung mit Folie anstatt der Netzwicklung. Die bisherigen Erfahrungen aus der Praxis sind positiv, wenn das Verfahren auf die Gärheubereitung beschränkt bleibt. Ungeeignet ist es hingegen für trockene Güter wie Stroh und Heu. Als Vorteil wird bei dem Folienbindesystem hervorgehoben, dass keine getrennte Entsorgung des Materials erfolgen muss, wie es ansonsten für die Netzbindung und Folienwickelung stattfindet. Nach Aussagen von Praktikern scheint das Futter in der Außenschicht dichter zu lagern. Weitere und intensivere Tests sind aber erforderlich, um beide Systeme „Folienbindung“ versus „Netzgarnbindung“ mit nachfolgender Folienwickelung vergleichend beurteilen zu können.
Mit hochwertigen Folien luftdicht einhüllen
Die Entwicklung ist auch für die Stretchfolien in den letzten Jahren vorangeschritten. So wird vor allem mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich der Gasundurchlässigkeit und einer Ersparnis an Folie infolge einer reduzierten Folienwickelung geworben. In der Tat lassen sich durch neue Formulierungen der Folien bessere Eigenschaften nachweisen. Doch ist Qualitätsware von den Billigprodukten nicht immer leicht zu unterscheiden. Achten Sie vor dem Kauf der Stretchfolie auf Angaben zur Dehn- und Reißfestigkeit, zur Durchstoßfestigkeit, zur wetterunabhängigen Wickelarbeit (Klebeeffekt) und nicht zuletzt zum mindestens einjährigem UV-Schutz.
Im Allgemeinen erfolgt das Einhüllen der Rundballen mit einer 6-fachen Aufbringung an Folienlagen. Die Anzahl der Folienlagen hat Einfluss auf die Gasdurchlässigkeit und damit auf den Besatz an Störkeimen. Für sehr sperriges, überständiges Futter ist bevorzugt eine 8-fache Umwickelung anzuraten.
Sorgfältig lagern
Die Ballen sind möglichst innerhalb von zwei Stunden nach dem Wickeln in die Folienhülle zu bringen. In der Praxis wird dieser Forderung recht gut entsprochen, da sich im Wesentlichen das kombinierte Press- und Wickelverfahren durchgesetzt hat. Alle enzymatischen und mikrobiellen Umsetzungsprozesse, die in dem Ballen ablaufen, dienen damit unmittelbar der Konservierung.
Bereits die kleinsten Löcher und Risse in der Folie stellen Eintrittspforten für Luft dar und sind Ausgangspunkt für das Verschimmeln und Warmwerden des Futters. Kontrollieren Sie deshalb jeden Ballen am Lagerort auf Beschädigungen und verschließen Sie die Löcher mit Siloklebeband.
Schäden durch Nagetiere oder Vögel kann man begegnen, wenn man die Rundballen auf festen Untergrund stellt und diese zusätzlich mit einem Schutznetz abdeckt.
Die Herstellung von Ballensilagen für die Pferdefütterung erfordert häufig noch weitere, verderbschützende Maßnahmen, da das Futter meist sehr spät geschnitten wird und die hygienischen Ansprüche sehr hoch sind. Diese Besonderheiten sind im Kasten vermerkt.
Besonderheiten bei der Rundballenbereitung für Pferde
Für Pferde wird das Futter im Allgemeinen besonders spät geschnitten. Mit Rohfasergehalten von deutlich über 25 % ist das Futter schwer verdichtbar. Ungünstig kommt hierbei noch hinzu, dass mit dem Alterungsprozess des überständigen Grasbestandes auch der Keimbesatz zunimmt.
Die Pflanzenbestände und die Grasnarbe von Pferdeweiden unterscheiden sich in aller Regel deutlich von den intensiven Milchviehweiden mit der Folge einer schlechteren Silierbarkeit und einer deutlich offeneren Narbe.
Um die Qualität trotz der ungünstigen Ausgangsbedingungen zu sichern, ist das Futter zumindest grob zu zerkleinern (Schnittlänge unter 30 bis maximal 50 cm). Die Ballen sollten mit mindestens 8 Folienlagen versehen werden.
Vermeiden Sie zudem ein zu tiefes Mähen, denn es führt zur Verschmutzung und zur erhöhten Staubbelastung. Zudem ist das Wiederergrünen des Bestandes bei zu tiefem Schnitt verzögert. Kommt dann noch eine weitere Trockenheitsphase hinzu, so kann die Grasnarbe gänzlich verdürren.
Auf ebenen Flächen und bei dichten Grasnarben sind Schnitthöhen von mindestens 7 cm akzeptabel. Höhere Schnitthöhen sollten dann gewählt werden, wenn das Gelände uneben ist oder sich die Bedingungen durch lockere Narben, Maulwurfshaufen, Lückigkeit o.a. ungünstiger darstellen.
Kontakte

Welsches Weidelgras ist schnittreif
Aus qualitativer Sicht war eine Ernte der Ackergrasbestände in den Regionen bis Mitte April an vielen Standorten angezeigt, sofern die Witterung es kurzfristig ermöglichte. Geringe Aufwuchshöhen unter 45 cm sowie Kleegrasbestände …
Mehr lesen...
Feldgras wächst gut
Um die Potenziale des überjährigen Anbaus von Feldgras bestmöglich zu nutzen, ist ein optimaler Schnitttermin des ersten Aufwuchses besonders wichtig. Die Landwirtschaftskammer beginnt in dieser Woche mit den Berichten zur Reifeprü…
Mehr lesen...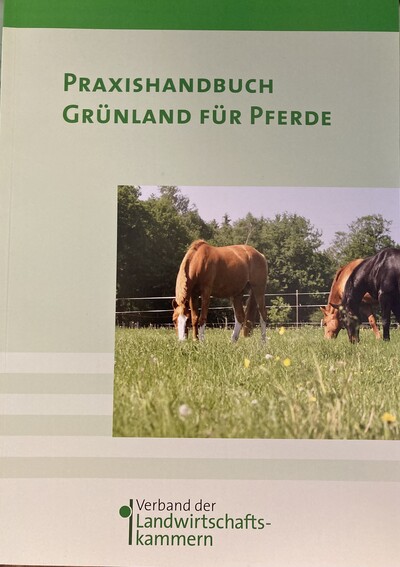
Nutzungshinweise und Tipps zur Pferdeweide
Pferdeweiden richtig pflegen Der Vegetationsbeginn im Grünland ist in diesem Jahr bereits im Februar erreicht worden und damit geht auch bald die Weidesaison wieder los. In diesem Frühjahr gilt es besonders, nach den sehr nassen …
Mehr lesen...
Spot Spray Verfahren im Grünland
In Niedersachsen werden rund 689.000 ha und somit 27 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche als Grünland genutzt. Chemischer Pflanzenschutz besitzt in der Grünlandbewirtschaftung nur eine geringe Bedeutung. Lediglich im Rahmen…
Mehr lesen...
Ergebnisse statt Auflagen
Förderung von Kennarten im Dauergrünland Vor wenigen Wochen haben wir die aktuellen Ökoregelungen (ÖR) der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für das Dauergrünland vorgestellt. Von diesem Förderprogramm mit einjä…
Mehr lesen...
Grünlanddüngung 2024
Die Befahrbarkeit der Flächen, der warme und regenreiche Winter sowie die überständigen Bestände gestalten die Grünlanddüngung in diesem Jahr schwierig. Wie ist zu reagieren und welche rechtlichen Punkte gilt es zu …
Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete
Veranstaltungen

GAP/Teil3: Praxisübungen „Regionale Kennarten im Grünland“
23.04.2024
Ort: Waffensen, Landkreis Verden - genauer Treffpunkt wird nach erfolgreicher Anmeldung bekannt gegeben Zum Hintergrund: Für viele Betriebe lohnte es sich im letzten Jahr, eine Teilnahmemöglichkeit der Ökoregelung Ö…
Mehr lesen...Beratungsangebote & Leistungen

Hinweis für Grünland und Ackerfutterbau
Sie sind Landwirt und versuchen Ihre Grünland- und Ackerfutterbauerträge und -qualitäten zu optiermieren und dabei so weit wie möglich Betriebsmittel einzusparen. Ihre tägliche Arbeit dreht sich dabei um Fragen zu der …
Mehr lesen...
Hinweise zum Integrierten Pflanzenschutz für die Landwirtschaft
Sie sind Landwirt und benötigen auf Ihre Region abgestimmte zuverlässige, neutrale und rechtssichere Informationen zum Pflanzenbau und Pflanzenschutz.
Mehr lesen...Drittmittelprojekte
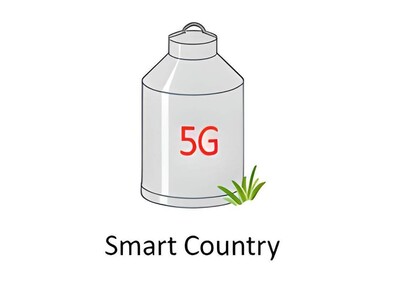
5G Smart Country
Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…
Mehr lesen...
Abibewässerung
Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …
Mehr lesen...
ADAM
Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…
Mehr lesen...
AGrON
Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …
Mehr lesen...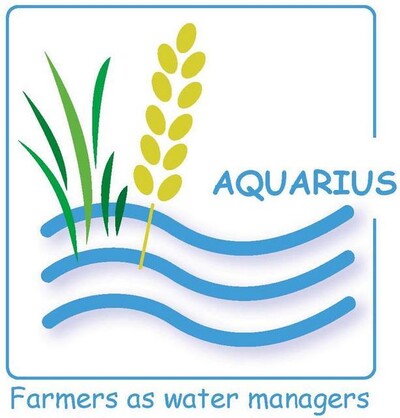
AQUARIUS
Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …
Mehr lesen...
Biotopverbund Grasland
Ausgangslage Hintergrund dieses Projektes ist der starke Rückgang artenreichen Grünlands und seine zunehmende Verinselung in landwirtschaftlich intensiv genutzten Räumen einerseits und der starke Flä…
Mehr lesen...