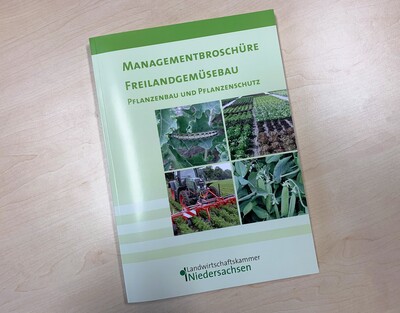In früheren Jahren waren in Norddeutschland Blattflecken die vorherrschende Krankheit im Möhrenlaub, während in Süddeutschland Echter Mehltau an erster Stelle stand. Die trockenen Jahre 2018 bis 2020 haben aber mittlerweile auch in Norddeutschland zu einem verstärkten Auftreten von Echtem Mehltau geführt.
Wichtig ist das Erkennen erster Befallssymptome auf dem Feld und die entsprechende Gestaltung der Fungizidstratgie.
Den kompletten Artikel mit aktuellem Zulassungsstand und wichtigen Informationen für die Fungizidstrategie finden Sie im Anhang.