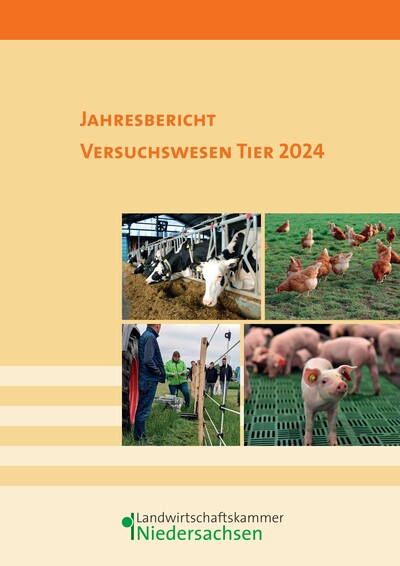Eine sorgfältige Diagnostik bei Schafen und Ziegen ist unerlässlich. Erste Anzeichen sind nur schwer zu erkennen und werden häufig übersehen, die Indikatoren sind vielfältig. Die/der Tierärztin/-arzt sollte um Rat gefragt werden, um dem Mangel von Spurenelementen gezielt zu begegnen.

Mit Blutproben den Status überprüfen
Bei nicht ganz so ausgeprägten anfänglichen Mangelerscheinungen fangen die Probleme mit auffälligen Bewegungsstörungen bei den etwas älteren Lämmern an (Spätform): müder, schwankender Gang. Unfähigkeit zum Aufstehen, Kurzatmigkeit. Auch hier kann es zu Todesfällen kommen. Bei den erwachsenen Tieren sieht man diese Bilder nicht. Vielmehr nehmen sie trotz guten Futterangebots nicht richtig zu und sind anfälliger gegenüber Wurmbefall oder anderen Erkrankungen. Ziegen zeigen oft ein struppiges Haarkleid. Häufig ist das Element Selen nicht ausreichend im Boden. Die Pflanzen brauchen kein Selen zum Wachsen. Also ist es schwierig einen ausreichenden Selengehalt im Futter (Bedarf: 0,5 mg/kg TS Selen/50 mg/kg TS Vitamin E) anzubieten. Bei einem Verdacht auf Vitamin E/Selenmangel ist es ratsam, die Versorgung über die Analyse von Blutproben zu überprüfen. Bei Unterversorgung ist eine Injektionsbehandlung mit einem entsprechenden Vitamin E/Selenpräparat vorzunehmen und konsequent ein selenhaltiges Mineralfutter anzubieten. Zur Begleitung des Verlaufs sollte man anhand von Blutproben zunächst regelmäßig den Status überprüfen.
Auch das Kupfer ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, welches mit der Nahrung aufgenommen werden muss. Ist nicht genügend Kupfer in der Nahrung vorhanden, kommt es zum so genannten primären Kupfermangel. Es ist jedoch auch möglich, dass andere im Boden oder auch im Futter vorkommende Stoffe wie Molybdän und Schwefel die Aufnahme des Kupfers im Körper verhindern; dann spricht man vom sekundären Kupfermangel.
Das klinische Bild des Kupfermangels ähnelt durchaus dem des Vitamin E und Selenmangels. Oft kommt beides auch parallel vor. Es werden gehäuft lebensschwache Lämmer geboren. Die Lämmersterblichkeit ist erhöht. Die Tiere zeigen Bewegungsstörungen, können nicht aufstehen. Meist ist das durch eine deutliche Hinterschwäche begründet. Die wiederum entsteht dadurch, dass die Bildung des Nervengewebes gestört ist. Bei Lämmern, die zunächst scheinbar problemlos heranwachsen, kann nach drei bis vier Monaten das so genannte Swayback auftreten. Sie entwickeln eine zunehmende Hinterhandschwäche, der Gang ist zunehmend schwankend, schließlich ist keine Bewegungskoordination mehr möglich. Die älteren Tiere sehen nicht gut genährt aus, Vlies oder Fell sind stumpf. Sie leiden unter Wollausfall, sind infektanfällig. Die Milchleistung sinkt. Auch Hautveränderungen können auftreten. Die Schleimhäute sind oft gelblich gefärbt.
Die Diagnose des Kupfermangels am lebenden Tier ist schwierig. Kupferbestimmungen im Blut sind möglich. Sie geben allerdings nur darüber Aufschluss, wie viel Kupfer sich gerade im Blut befindet. Die Leber ist der eigentliche Speicherort. Erst wenn dort ein zu geringer Gehalt (Leber von Schlacht- oder verendeten Tieren) nachgewiesen wird, ist die Diagnose gesichert. Das sollte sie sein, denn die Behandlung des Mangels erfolgt über orale Kupfergaben und birgt das Risiko der Kupfervergiftung.
Gefahr der Überversorgung gegeben
Die akute Kupfervergiftung kommt nicht so häufig vor. Sie soll aber an dieser Stelle genannt werden, um die Gefahr der Überversorgung deutlicher zu machen. Denn es ist so, dass es sich bei den Spurenelementen um chemische Elemente mit hoher Toxizität (Giftwirkung) hangelt. Und eine überdosierte Behandlung kann Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Die Balance zwischen Unter- und Überversorgung ist insbesondere beim Schaf eine Gratwanderung. Die Ziege ist da etwas großzügiger. Man sollte also eine Ration zusammenstellen, in der die Gehalte von 12 bis 15 mg Kupfer/kg Trockensubstanz (TS) der Gesamtration nicht überschritten werden, um den Tieren das Spurenelement Kupfer ausreichend zur Verfügung zu stellen, ohne Vergiftungserscheinungen zu provozieren.
Bekommt das Schaf also entweder durch eine einmalige Gabe oder auch in kleineren Mengen über einen längeren Zeitraum zu viel Kupfer, kann sich das verheerend auswirken und es entsteht das Bild der Kupfervergiftung. Die Erscheinungen der chronischen Kupfervergiftung bei erwachsenen Tieren entsprechen in etwa denen des Kupfermangels. Sie werden oft nicht erkannt. Hat man aber den Verdacht einer Überversorgung, gibt auch in diesem Fall die Leberanalyse Aufschluss. Auch eine Analyse des verdächtigen Futters hilft hier weiter.
Zu viel Kupfer kann zum Beispiel in Kraftfutter für Rinder oder auf Flächen, die mit Schweinegülle gedüngt wurden, enthalten sein. Wenn die Tiere nach einer gewissen Zeit absolut zu viel Kupfer aufgenommen und in der Leber gespeichert haben, kommt es zu Entspeicherung der Leber und damit zur akuten Kupfervergiftung. In ihrer akuten Form nimmt die Vergiftung einen dramatischen Verlauf. Möglicherweise hat das eindrucksvolle klinische Bild der akuten Kupfervergiftung dazu geführt, dass in vielen Schafmineralien kein Kupfer enthalten ist. Im Vordergrund stehen die durch eine Art Leberversagen hervorgerufenen Symptome. Die Tiere fressen nicht mehr und sind kurzatmig. Die Schleimhäute nehmen eine gelbe Farbe an und Blutharnen ist möglich. Die Sterblichkeit ist hoch, eine Behandlung ist praktisch nicht möglich.
Die Hirnrindennekrose ist vornehmlich eine Lämmererkrankung und kommt durch einen Mangel eines Vitamins der B-Gruppe des Vitamin B1, auch Thiamin genannt, zustande. Das Thiamin wird teilweise mit der Nahrung aufgenommen und teils von Bakterien im Pansen gebildet. Es gibt drei Möglichkeiten, wie es zum Mangel kommen kann. Es fehlt in der Nahrung, es wird von Inhaltsstoffen von Pflanzen (Thiaminasen) gespalten oder der Pansen arbeitet nicht richtig, so dass die Bakterien, die sich bei gestörter Pansenfunktion dort ansiedeln, ebenfalls Thiaminasen produzieren. Fehlt nun das Vitamin, können Körperzellen nicht ausreichend mit Energie versorgt werden. Da die Gehirnzellen den höchsten Bedarf an Energiezufuhr haben, sind sie am stärksten betroffen. Und in der Großhirnrinde sterben sie als erstes ab. Dieses Absterben der Großhirnrinde führt zu den typischen Erscheinungen. Mit extrem nach hinten/oben überstrecktem Kopf liegen die Tiere auf der Seite mit Muskelzittern und Krämpfen, die sich geräuschabhängig verstärken können. Bei Nichtbehandlung verenden sie meistens. Die Erkrankung kann auch bei älteren Tieren auftreten, sieht dann auch genauso aus. Die Behandlung erfolgt über wiederholte Thiamingaben per Injektion am besten direkt ins Blut und ist durchaus erfolgreich, wenn sie früh genug erfolgt. Entsprechend der auslösenden Ursache, welche nicht klar zu benennen ist, sollte eine Fütterungsumstellung oder eine verbesserte Zufuhr von Thiamin vorgenommen werden.
Bei der Pansenazidose handelt es sich, wie der Name bereits sagt, um eine Übersäuerung des Pansens. Die kleinen Wiederkäuer haben mehrere Mägen und im größten von ihnen, dem Pansen, findet der Nahrungsaufschluss, die Bildung von Vitaminen usw. mit Hilfe der Pansenbakterien statt. Die Pansenbakterien benötigen dafür ein alkalisches Milieu. Verändert sich der Säuregehalt im Pansen zum Beispiel durch die Aufnahme zu großer Mengen von Zucker (Kohlenhydraten), gerät das Gleichgewicht der Pansenbakterien durcheinander. Dieses kann allmählich entstehen, wenn über längere Zeiträume zu kohlenhydratreich gefüttert wird.
Bei dieser chronischen Übersäuerung kann z.B. der Entstehung der Hirnrindennekrose (CCN) Vorschub geleistet werden. Die Tiere fressen nicht mehr gut, haben einen steifen Gang, Fieber und Durchfall. Dann genügt es in der Regel, das kohlenhydratreiche Futter zunächst abzusetzen und über mehrere Tage rohfaserreiches Futter und Wasser anzubieten. Anschließend sollte eine langsame Gewöhnung an die Ration erfolgen.
Geschieht die Übersäuerung akut, also wenn sich ein "verfressenes" Tier über einen einsamen Eimer mit Rübenschnitzeln hermacht oder es im Spätsommer auf eine Weide mit Obstbäumen geht, passiert das Ganze sehr schnell. Innerhalb von wenigen Tagen löst sich die Pansenschleimhaut durch die aggressive Wirkung der Säure ab. Das Tier hat starke Schmerzen, hört auf zu fressen, bekommt wässrigen Durchfall und oft kommt es zum Festliegen und zum Tod. Bei der Behandlung gilt es, die Säure schnellstens zu neutralisieren und das Pansenmilieu wieder herzustellen: Absetzen des zuckerreichen Futters, Flächenwechsel, Stroh und Wasser geben, Eingabe von puffernden Arzneimitteln und Versorgung mit Vitamin B. Auch die Eingabe von Pansensaft (von Schlachttieren gewonnen) hat sich bewährt. Bei schweren Krankheitserscheinungen kommt die Behandlung meist zu spät. Der Heilungsprozess dauert lange. Bei überstandener Krankheit kommt es später häufig zu oft generalisiertem Wollausfall.