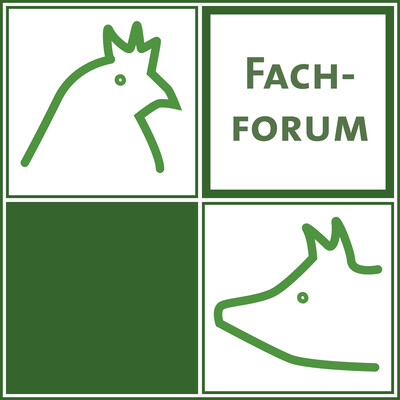Drittmittelprojekte als Innovationsmotor – Stationen widmen sich den Fragen der Praxis

Um Niedersachsens Landwirtinnen und Landwirte bei den kommenden Herausforderungen mit der gewohnten fachlichen Expertise beraten zu können, investiert die Landwirtschaftskammer bereits heute zielgerichtet in die Zukunft.
Der „Transparente Maststall“ in der Leistungsprüfungsanstalt Quakenbrück-Vehr ist ein exaktes, standardisiertes Prüfsystem für Nährstoffströme, Input-Output-Faktoren, biologische Leistungen, Fütterungseffizienz, Flüssigmistanfall/-konzentration, Emissionen und Immissionen (Webcode: 01026676 und 01037668).
Auf der Versuchsstation für Schweinehaltung in Bad Zwischenahn-Wehnen werden praxisorientierte Lösungsansätze zu hochaktuellen Problemfeldern der konventionellen Schweinehaltung untersucht. Seit 2016 bilden insbesondere Drittmittel finanzierte Verbundprojekte den Innovationsmotor der VST Wehnen. Im Projekt „InnoPig –Vergleich von verschiedenen Abferkelsystemen“ wurden über 2.000 Tiere ausgewertet. Die Ergebnisse wurden der Praxis, aber auch den Landes- und Bundespolitikern vor Ort dargestellt. Eine neutrale Fakten- und Entscheidungsbasis für sowohl schweinehaltende Betriebe als auch für gesetzliche Vorgaben konnten geliefert werden (z. B. TierSchNutztV- Teilfixierung der Sau zum Ferkelschutz). Zwei Jahre später startete das Verbundprojekt zum Verzicht auf das Schwanzkupieren beim Schwein (KoVeSch, Webcode: 01036824). In so genannten Komfort Plus Buchten sollten Risikofaktoren für Schwanzbeißen möglichst minimiert werden. Dieses Vorhaben wurde gleichzeitig auf mehreren Versuchsstandorten in der Bundesrepublik durchgeführt. Im Jahr 2020 startete ein weiteres Verbundprojekt mit dem Titel: Cross Innovation und Digitalisierung in der tiergerechten Schweinehaltung unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes (DigiSchwein). Dabei wurden verschiedene digitale Technologien für die Schweinehaltung näher untersucht und ein Prototyp eines Dashboards zur Früherkennung von Veränderungen/Krankheiten entwickelt (https://demo.digischwein.uni-oldenburg.de/). Die Erkenntnisse aus dem Projekt DigiSchwein werden derzeit auch im Projekt zur digitalen Rückverfolgbarkeit und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette Schwein (TiPP) verwendet und auf Praxisbetrieben eingesetzt.
Neben diesen Projekten finden auch laufend weitere Projekte zum Thema Emissionsminderung im Außenklimastall des Standortes statt. Nachdem die Projekte EmiDaT (https://www.ktbl.de/themen/emidat) und EmiMin (https://www.ktbl.de/themen/emimin, Webcode 01036130) mittlerweile abgeschlossen sind, laufen derzeit die Untersuchungen im Folgeprojekt EmiMod (https://www.ktbl.de/themen/emimod), in dem es um die Weiterentwicklung von Methoden zur Erfassung, Modellierung und Beurteilung des Emissionsgeschehen geht.
Um zuverlässige Ergebnisse für die spätere Betriebsberatung und den Wissenstransfer in die landwirtschaftliche Praxis zu erhalten, sind zwischen den unterschiedlichen Projekten häufig größere bauliche Anpassungen am Stallgebäude bzw. den darin verbauten Haltungssystemen durchgeführt worden.
Die nächste Herausforderung ist die neue Konzeptionierung des Deck- und Wartebereichs für Sauen. Der Schwerpunkt wird auf einem exakten Messsystem für Tierwohl, nachhaltige-biologische Leistungen, den Anfall an Nährstoffen sowie zur Reduzierung von Emissionen und Immissionen liegen.
Neben eigenen Mitteln für das Versuchswesen Tier stammt der Großteil der hierfür benötigten Gelder aus den zuvor genannten Drittmittelprojekten. Dies verdeutlicht die enorme Innovationswirkung und Aktualität Drittmittel geförderter Projekte an der VST Wehnen, welche auf diese Weise einen entscheidenden Beitrag zur Klärung praxisrelevanter Haltungsfragen leistet.