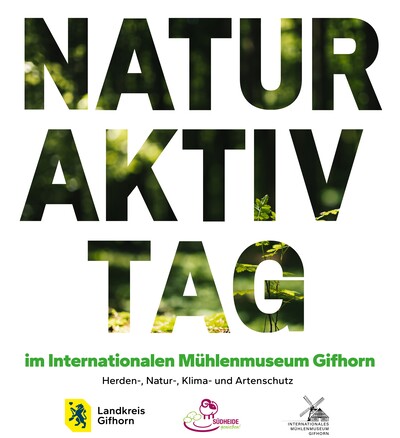Weidetiere haben unterschiedliche Anforderungen an eine ausbruchsichere & wolfsabweisende Zäunung

Der Druck auf die Weidetierhalter, Behörden und nicht zuletzt auf die Politik steigt ständig. Die Risszahlen des Monitorings vor allem bei Schafen und Ziegen weisen nach wie vor ein hohes Niveau auf.
Im März 2021 wurde eine Musterzaunanlage zur wolfsabweisenden Zäunung auf dem Gelände des Lehr- und Bildungszentrums in Echem errichtet. Zaunmaterial zum Anfassen und der fachliche Austausch über Lehrgänge und Besichtigungen sind wichtig, um den neuen Herausforderungen in der Weidetierhaltung begegnen zu können. Das Wissen rund um Zaunbau und Zaunmanagement wurde bisher von Generation zu Generation weitergegeben, erfuhr aber bis zur Wolfsrückkehr keine besondere Aufmerksamkeit.
Bevor die Zauntypen für die einzelnen Tierarten beschrieben werden gibt es ein paar Gemeinsamkeiten. Der Zaun muss höher sein als es bisher nötig war und jeder Zaun benötigt einen Untergrabe- sowie Überkletterschutz. Grundsätzlich versucht der Wolf, bodennah und spurfolgend in eine Weide einzudringen. Durch Grabungen direkt am Knotengeflecht versucht er, Beute zu machen. Der Wolf ist ein sehr effizienter Jäger und prüft die Zäunung nach Schwachstellen oder leichten Eindringmöglichkeiten. Aus diesem Grund ist auch ein Augenmerk auf die Tore und die angrenzende Umgebung des Zaunes zu legen. Das Eindringen wird z.B. durch Höhenunterschiede im Gelände, Baumstämme, oder nicht ausgezäunte Gewässer begünstigt.

Mechanisch abweisend wirken z.B. Knotengeflechtzäune. Diese werden für Wildgehege und bei kleinen Wiederkäuern eingesetzt. Ältere Zäune sind meist nur auf den Boden aufgesetzt. Bei diesen Zäunen muss ein Untergrabeschutz eingerichtet werden. Zum einen ist die Auslegung eines gleichen Materials an der Zaunaußenseite möglich. Dieses 1 m breite Geflecht wird dann mit Ankern fixiert und am Zaun angerödelt. Einige Hersteller haben bei neuen Geflechten ein Gelenk eingebaut, um ein leichteres Abwinkeln zu ermöglichen. Diese sog. „Schürze“ benötigt Platz, findet aber Ihren Einsatz an Böschungskanten oder wenn eine Elektrifizierung nicht umgesetzt werden kann.
Ein Untergrabeschutz ist auch durch die Anbringung eines Stahldrahtes auf 20 cm Höhe und in einem Abstand von 15 cm an der Außenseite des Zaunes herzustellen. Stahl ist ein langlebiges, robustes und gut leitfähiges Material. Als positiver Effekt ist die abschreckende Wirkung auf den Wolf zu erwähnen. Bei Neuanlagen kann das Knotengeflecht auch 30 cm tief in den Boden eingegraben werden. Allerdings ist hierbei ein Geräteeinsatz erforderlich und nicht jedes Gelände ist geeignet. Besonders aufwendig wird es, wenn Schonungen oder auch Baumgruppen an der Weide angrenzen.
Bei den Knotengeflechtzäunungen haben sich dickeres Material (ab 2,5 mm) und Knotungen, die sich nicht verschieben können, bewährt. Häufig ist bei einfachen Qualitäten der untere Bereich zu dicht geknüpft, so dass Wildtiere kaum passieren können.
In der Schaf-/Ziegenhaltung kommen neben der Einzäunung von Standweiden mit einem Festzaun vor allem Mobilzäune zum Einsatz. Hier sind die Elektronetze weit verbreitet, die die geforderten 20 cm Litzenabstände im Geflecht integriert haben. Die Schwierigkeit bei Mobilzäunen ist die Gewährleistung von Standhaftigkeit, Spannung des Materials und korrektem Aufbau auch bei Sturm oder widrigen Wettereinflüssen. Pfähle mit einer Doppelspitze sind vorteilhaft. Unter den Herstellern gibt es große Qualitätsunterschiede. Hochwertige Netze sind haltbarer und die Pfähle verbiegen sich nicht so schnell. Die niedersächsische Förderrichtlinie (Richtlinie Wolf) sieht einen Grundschutz mit einer Mindesthöhe von 105 cm vor, die immer erreicht sein muss. Der wolfsabweisende Grundschutz im Rahmen der Billigkeitszahlungen (und auch zur Erfüllung der Vorgaben der RL SchaNa) bleibt zunächst weiterhin bei 90 cm. Um gerade bei Mobilzäunen die Höhe im Gebrauch/ im Alltag zu gewährleisten, wird eine Erhöhung mit einer Litze oder ein höheres Netz mit 105 cm empfohlen. Sicherlich wäre ein 120 cm hohes Netz noch besser, aber höhere Netze sind schwerer und unhandlicher im Gebrauch. Häufig wird hier ein niedrigeres Netz mit zusätzlichem Breitband erhöht. Die dafür benutzten Pfähle dienen auch zur zusätzlichen Stabilisierung des mobilen Netzes. Ist der Untergrund zu hart oder kann keine Erdung angebracht werden sind Elektronetze mit dem +/-Wirkprinzip (Erdleiter abwechselnd im Netz verarbeitet) mittel der Wahl. Es sollte flächenspezifisch das passende Netz ausgewählt werden
Beim Pfahlkauf für mobile Zäunungen für alle Weidetierarten haben sich Produkte, an denen die Isolatoren individuell verschoben werden oder an denen Löcher nachgebohrt werden können (Winkelstahl) bewährt.
Für alle ortsfesten und mobilen Reihenzäune gelten aktuell folgende Abstände: 20 cm zum Boden, 20 cm Abstand zur nächsten Reihe, max. 20 cm zur dritten Reihe und ab der vierten Reihe jeweils max. 30 cm zueinander.
Bei der Verwendung von Elektronetzen und Zaunanlagen ohne Netzanschluss muss ein wesentliches Augenmerk auf die Erdung und Elektrifizierung gelegt werden. Je nach Boden- und Geländebeschaffenheit kommen zusätzliche Anforderungen auf die Weidetierhalter zu. Je trockener der Boden, umso höher sind die Anforderungen an die Erdung. Auch 1 m und längere Erdstäbe aus verzinktem Stahl und eine höhere Anzahl von Erdstäben begünstigen eine gute Erdung. Bodeneinsteckhülsen können sehr gut als Erdungspfahl genutzt werden. Vorteilhaft ist der lange Dorn, der tief in die Erde eingeschlagen werden kann (bitte Einschlaghilfe und Gummihammer verwenden). Der Dorn ist aus gekreuzt verzinktem Stahl hergestellt und bietet deutlich mehr Leitoberfläche und die Bohrlöcher an der oberen Hülse sind ideal zur Montierung des Verbindungsmaterials am eigentlichen Zaun. Als Faustformel gilt: So viele Erdstäbe verwenden, wie das Elektrifizierungsgerät an Entladeenergie aufweist! Beträgt die Entladeenergie z. B. 9 Joule so sollten auch 9 Erdstäbe eingeschlagen werden. Beim Zaunbau sollte auf feste, hochwertige und materialgleiche Verbindungen zwischen den Stäben und dem Zaun geachtet werden. Wasserspeicherndes Material wie z. B. bentonithaltiges Katzenstreu/ Bentonit (Tonmineralgemisch) haben einen hohen Wirkungsgrad auf die Erdung. Mehr als 500 Volt sollte die Erdung bei der Prüfung nicht anzeigen.
Die Weidezaungeräte sollten mind. 1 Joule Entladeenergie aufweisen und nicht über- oder unterdimensioniert sein. Solarunterstützung bei akku-/batteriebetriebenen Geräten sorgen für eine dauerhafte Funktion. Diebstahlschutz schützt vor Vandalismus, z. T. kann auch das Gehäuse unter Strom gesetzt werden oder abschließbare Vorrichtungen den Diebstahl minimieren. Die Spannung sollte am entferntesten Punkt zum E-Gerät immer mind. 4.000 Volt erzielen. App-gesteuerte E-Geräte erleichtern die Kontrolle und die Dokumentation und geben bei mehreren Flächen einen sehr guten Überblick.
Vor dem Setzen der Netze/des Zaunes sollte der Untergrund vorbereitet werden. Forstmulcher haben sich bei der ortsfesten Neuanlage eines Zaunes gut bewährt. Damit wird eine schneisenartige Begradigung und eine aufwuchsreduzierende Wirkung erzielt. Nur junger Aufwuchs könnte bei starken E-Geräten auch „weggebrannt“ werden.
Nachfolgende Tipps tragen zur Arbeitserleichterung bei: Ein optisches Signal über eine kleine Klemmlampe zeigt auch bei widrigen Wetterverhältnissen schnell an, ob der Zaun „Saft hat“. Prüfgeräte mit anzeigender Funktion, in welcher Richtung der Leistungsabfall zu finden ist, sind hilfreich und sparen Zeit. Frost, Regen und Schnee sind natürliche Leistungskiller. Bei der Elektrifizierung und im Zaunmanagement sollten Verbindungen von mehreren Netzen immer mit den passenden Klemmen und Verbindungselementen des Herstellers erfolgen.
Gräben und Gewässer benötigen eine erhöhte Aufmerksamkeit, da ein Wolf auch über die wasserführende Seite in die Weide eindringen kann. Ist ein Graben nicht permanent wasserführend, kann an der untersten Leitermaterialreihe ein sog. Energiebegrenzer eingebaut werden. Dieser verhindert den kompletten Kurzschluss der Zaunanlage und schaltet bei Wasserkontakt nur die unterste Reihe ab. An einigen Flächen kann auch der Grabendurchschnitt für eine durchgezogene Zäunung mit einer Mauer oder mit Rohrelementen verkleinert und durch ein Gitter wolfsabweisend gestaltet werden.
Doch wo stößt die wolfsabweisende Zäunung an Ihre Grenzen?
Diese Frage kann auf zwei Ebenen beantwortet werden. Das eine ist die Frage nach der max. Zumutbarkeit für den einzelnen Tierhalter mit seiner aktuellen Bewirtschaftungsform und mit seinem aktuellen Tierbestand. Das andere ist die Kulturlandschaft, die den Landkreis oder das Bundesland prägt. Historisch gewachsene Landschaften wie z.B. in Ostfriesland, in der Wallhecken eine natürliche Einfriedung der kleinparzelligen Flächen darstellen, erschweren eine wolfsabweisende Zäunung. Die Wallhecken sind Landschaftselemente mit hohem Erhaltungswert. Die erhöhten Wälle verlangen aber einen großen Zaunabstand, damit keine Einsprunghilfen für den Wolf geboten werden. Doch dann können Flächen evtl. nur noch mit einer geringeren Tieranzahl beweidet werden. Um die Codierung weiterhin auf der gesamten Fläche zu erhalten, muss eine Bewirtschaftung auch zwischen der Zaun- und Schlaggrenze erfolgen (z.B. durch mulchen). Erste Überlegungen sind angeschoben und es zeigt, dass nicht nur die Bewirtschafter sich mit der Situation auseinandersetzen müssen, sondern weitere Akteure dialogbereit sein sollten.
Grundsätzlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz durch die Zäunung. Die hundertprozentige Ausbruchsicherheit gab es vorher aber auch nicht. Eine Aktualisierung oder zumindest Überprüfung der bisherigen Zäunung ist wichtig, um auf dem neuesten Stand zu sein. Die Dynamik bei der Ausbreitung des Wolfes muss aus allen Blickwinkeln wahrgenommen werden, um zwischen dem „Garnichtstun“ und der Entnahme eine möglichst große Akzeptanz zu erreichen.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind Sachlichkeit und eine Vermeidung von Schuldzuweisungen. Nur gemeinsam kann man sich konstruktiv und zielführend dieser neuen Herausforderung stellen. Der Wolf war bisher nicht heimisch und fordert uns nun heraus. Für die Herdenschutzberatung ist dies ebenfalls ein dynamischer Prozess. Die Veränderung in der Tierhaltung ist auch auf der Weide angekommen. Für Fragen zur wolfsabweisenden Herdenschutzzäunung stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter der LWK Niedersachsen gerne zur Verfügung.
Niedersachsenweit können alle Schaf-/Ziegen- oder Gehegewildhalter einen Antrag auf Zaunmaterial und/oder Herdenschutzhunde stellen (Grundschutz)
Rinder- und Pferdehalter haben bei direkter oder indirekter Betroffenheit eine Möglichkeit auf eine Zaunförderung
Bitte melden Sie Wolfssichtungen!! Bei der Landesjägerschaft Niedersachsen unter www.wolfsmonitoring.com oder NEU über die kostenlose App „Wolfsmeldungen Niedersachsen“
Oder auch an die örtlichen Wolfsberater des nds. Wolfsbüros. Eine aktuelle Liste finden Sie unter: www.nlwkn.niedersachsen.de/wolfsberate
Aus gegebenen Anlass:
Bitte melden Sie alle Nutztierrisse bei Ihrem zuständigen Bezirksförster der LWK oder unter der folgenden Risshotline: 0511 3665-1500.
Nur mittels amtlicher Bestätigung können Billigkeitsleistungen erfolgen!!