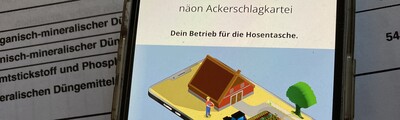Erste Feldbegänge 2025 zeigen in anfälligen Sorten von Wintergerste und Winterroggen bereits Befall mit Zwerg- und Braunrost. Ob es zu einer weiteren Ausbreitung der Pilzkrankheiten auf die ertragsrelevanten Blattetagen kommt, ist von der Folgewitterung abhängig. Mit welcher Fungizidstrategie auf die unterschiedlichen Infektionsbedingungen reagiert werden kann, wird nachfolgend beschrieben.
► Tabelle Ausgewählte Fungizide zur Bekämpfung von Pilszkrankheiten in Getreide
Neue Präparate für die Saison 2025:
Das reichliche Angebot der reinen Prothioconazol-haltigen Präparate wird 2025 durch SORATEL der Firma ADAMA sowie JOUST der Fa. Nufarm erweitert (Tab. 1). Neue Prothioconazol-haltige Mittel mit zusätzlichem Mehltau-wirksamen Wirkstoff sind Forapro (ADAMA), welches kurativ über Fenpropidin eine gute Mehltau-Stoppwirkung erwarten lässt, sowie CHEROKEE Neo, welches mit Spiroxamine eine Mehltauwirkung besitzt.
Das Produkt Navura (BASF), bestehend aus den Azolkombinationen Prothioconazol und Mefentrifluconazol, verspricht eine breite Wirkung mit Schwerpunkten u.a. gegen Ramularia, Septoria und Fusarium. Ebenso neu in 2025 ist das Präparat Xenial (BASF), bestehend aus Pyraclostrobin, Metrafenone und Mefentrifluconazol, welches breit wirksam z.B. gegen Rhynchosporium, Roste, Netzflecken und Ramularia ist und von BASF für die T1-Behandlungen positioniert wird.
Als neue Packlösungen 2025 sind zu nennen:
- Univoq Xtra bestehend aus Univoq + Regoral (Azoxystrobin) mit einer Aufwandmenge von 1,5 + 0,3 l/ha in Weizen, Triticale und Roggen.
- Elatus Era Star bestehend aus Elatus Era + Amistar mit einer Aufwandmenge von 1,0 + 0,5 l/ha in Weizen, Gerste, Roggen und Triticale.
- Avastel Pack: Pioli + Soratel mit einer Aufwandmenge von 1,5 + 0,75 l/ha in Weizen, Gerste, Roggen und Triticale.
Resistenzentwicklung:
Grundsätzlich sind Carboxamid- oder Strobilurin-Wirkstoffe besonders resistenzgefährdet. Dies ist dadurch begründet, dass sie nur an einem Wirkort in der Atmungskette des Pilzes eingreifen. Bei der Bekämpfung von Netzflecken in Gerste ist bereits seit längerem eine Zunahme nicht sensitiver Isolate gegenüber Carboxamiden bekannt. Von den Strobilurin-Wirkstoffen hat das Pyraclostrobin noch die sicherste Wirkung gegen Netzflecken. Gegenüber Ramularia zeigen die Strobilurine kaum noch Wirkung, bei den Carboxamiden nimmt die Resistenz deutlich zu.
Wie kann gegen dieses Pathogen reagiert werden?
Von den Azolwirkstoffen versprechen Mefentrifluconazol (Revysol) und etwas abgestuft Prothioconazol noch einen guten Wirkungsgrad. Einen wichtigen Beitrag im Resistenzmanagement bei der Ramulariakontrolle bietet der Kontaktwirkstoff Folpet (Folpan). Dieser kann den Wirkungsgrad in Kombination mit Azol/SDHI Kombiprodukten noch um ca. 20% verbessern, vorausgesetzt die Behandlung wird ab BBCH 49 d.h. Grannenspitzen gesetzt. Frühere Maßnahmen z.B. in BBCH 39 oder zur T1 reduzieren den Wirkungsgrad.
Eine weitere integrierte Maßnahme um den Krankheitsdruck zu vermindern, besteht in der Auswahl z.B. geringer Ramularia-anfälliger Sorten wie z.B. Julia, KWS Exquis oder SY Loona.
Empfehlungen:
► Wintergerste
Einfachfungizidmaßnahmen: (Abb. 3)
Die einmalige Anwendung von Fungiziden in der Vegetationsperiode ist in Wintergerste für die Bestände geeignet, auf denen sowohl ein verzögertes Auftreten an Blattkrankheiten als auch der Anbau blattgesünderer Sorten wie z.B. KWS Exquis, Esprit oder SY Loona grundsätzlich die Schadenswahrscheinlichkeit senkt. Bei der Strategie Einfachmaßnahme muss die Spritzung in der Regel ca. 1 Woche früher als die Abschlussmaßnahme in einer Spritzfolge erfolgen. Dadurch besteht grundsätzlich die Gefahr, später auftretende Infektionen insbesondere mit Ramularia nicht mehr sicher zu erfassen. Aus diesem Grund sollte die Aufwandmenge der eingesetzten Präparate, die zwischen BBCH 39 (Fahnenblattstadium) und BBCH 49 (Grannenspitzen) eingesetzt werden, höher sein als in der Spritzfolge. Geeignete Präparatkombinationen sind z.B. Ascra Xpro, Elatus Era und das Avastel Pack, die unter Ramularia-Befallsbedingungen mit Folpan 500 SC kombiniert werden. Die Tankmischung aus Revytrex plus z.B. Joust ist ebenso gegen Ramularia sehr wirkungsvoll. Da hierbei kein Folpan 500 SC zur Anwendung kommt, ist pflanzenschutzrechtlich der Gewässerabstand bei 1m ab Böschungsoberkante relevant.
Zweifachfungizidmaßnahme: (Abb. 4)
Tritt wie 2024 bereits Befall an Blattkrankheiten wie Zwergrost, Rhynchosporium und Mehltau im Schossen auf, ist eine Zweifachspritzfolge sicherer. Beim ersten Termin bieten sich Präparate wie z.B. Orius oder Folicur oder auch Forapro an, wenn neben Rost und Netzflecken starker Mehltau auftritt. Bei vorrangigem und stärkerem Netzfleckenbefall kann auch das Cyprodinil-haltige Kayak zum Einsatz kommen. Häufig tritt gleichzeitig Zwergrost auf, so dass einem Kayak (0,75 l/ha) ein Azol wie z.B. Orius (0,6 l/ha) oder auch Protendo 250 EC mit 0,5 l/ha hinzugefügt werden kann.
Eine zweite Fungizidmaßnahme ab dem Grannenspitzen (BBCH 49) muss gegen späte Infektionen insbesondere gegenüber Ramularia Sicherheit bringen. Hier bieten sich Ramularia-wirksame Kombinationsprodukte wie Ascra Xpro 0,8 l/ha oder Revytrex 1,0 l/ha an. Die Wirksamkeit gegen Ramularia wird durch die Zugabe von Folpan 500 SC mit 1,25 l/ha deutlich erhöht. Zeichnet sich zur Abschlussmaßnahme ein sehr starker Befallsdruck mit Ramularia ab, kann z.B. Revytrex 1,0 l/ha mit Proline oder Joust 0,4 l/ha sowie mit Folpan 500 SC 1,25 l/ha kombiniert werden. In der Spritzfolge sollte auf den Azolwechsel geachtet werden. Die Fungizidspritzfolge ermöglicht es, die Abschlussbehandlung bis ins Ährenschieben hinauszuzögern. Zu diesem Einsatztermin werden neben den oberen Blättern auch die wesentlich an der Ertragsbildung beteiligten Grannen und Spelzen der Ähren direkt benetzt.
Versuch Wintergerste: (Grafik 1)
Um Aufschluss über die Wirksamkeit von Fungizidmaßnahmen zu erlangen, wurde von der LWK Niedersachsen ein Gemeinschaftsversuchsprogramm durchgeführt. In den Versuchen waren Zwergrost und Ramularia die dominierenden Blattkrankheiten. Dabei wurde zum frühen Termin in BBCH 32-34 unterschiedliche Azole in ihrer Wirksamkeit geprüft. In zwei Varianten wurde keine T1- Maßnahme durchgeführt.
Aus den Versuchen wird deutlich, dass im Versuchsjahr 2024 die Vorlage eines Azols die Wirkung auf Zwergrost und Ramularia verbessert hat. Die Zugabe des Kontaktmittels Folpan (Var. 10) zum Proline im T1-Termin zeigte keine Wirkungsverbesserung gegen Ramularia. Weitere Versuche aus früheren Jahren belegen aber auch die hohe Wirksamkeit des Folpan gegen Ramularia bei der Zugabe zur Abschlussbehandlung. Festzuhalten bleibt auch, dass die eingesetzten Azolfungizide (T1-Termin) zu einer signifikanten Ertragsabsicherung 2024 führten.
Hingegen war aus der Differenzierung der Abschlusstermine (vor/nach dem Ährenschieben) keine Ertragswirkung abzuleiten, gleichwohl die spätere Abschlussbehandlung einen besseren Wirkungsgrad gegen Ramularia zeigte.
► Winterroggen (Abb. 5)
Eine gezielte und wirkungsvolle Kontrolle von Braunrost stellt einen wesentlichen Beitrag für die Ertragsabsicherung dar. Das aktuelle Sortenspektrum in Winterroggen besitzt zudem eine Reihe von Sorten mit verbesserter Festigkeit gegenüber Braunrost. Hierzu gehören z.B. die Sorten KWS Baridor oder SU Karlsson.
Bei geringem und spätem Befallsdruck mit Braunrost kann zum Ährenschieben mit lang wirkenden Kombinationsprodukten wie z.B. Elatus Era (0,8 l/ha), Balaya (1,2 l/ha) oder auch Azbany (0,7 l/ha) + Folicur (0,7 l/ha) mit etwas geringerer Dauerwirkung behandelt werden.
Zeigen Feldkontrollen bereits zu Beginn des Schossens zunehmenden Braunrostbefall an, sollte ein Fungizideinsatz mit rostwirksamen Mitteln wie z.B. Orius (1,0 l/ha) oder Panorama (0,3 l/ha) durchgeführt werden. Tritt Mehltau gleichzeitig auf, kann z.B. ein Verben (0,6 – 0,7 l/ha) gewählt werden. Dort, wo aufgrund sehr früher Aussaattermine zusätzlich Infektionen mit Halmbruch zu berücksichtigen sind, besitzt z.B. Unix + Pecari 300 EC (0,5 + 0,5 l/ha) oder Input Triple mit 0,8 - 1,2 l/ha Wirkung gegen diese Krankheiten. Mit diesen Mitteln wird gleichzeitig Rhynchosporium kontrolliert. Entscheidend für die Vermeidung eines hohen Halmbruchrisikos sind angepasst spätere Aussaattermine.
Im Roggen stellt die Abschlussmaßnahme ab BBCH 49/51 über Jahre hinweg die wichtigste und in vielen Fällen einzig notwendige Fungizidmaßnahme dar. Bei der Präparateauswahl ist zu beachten, dass eine langanhaltende Wirkung auf Braunrost gefordert ist. Dies kann über Fungizide sichergestellt werden, die Wirkstoffe aus der Gruppe der Carboxamide und Strobilurine enthalten. Hierzu gehören Mittelkombinationen wie z.B. Elatus Era + Amistar (0,8 + 0,4 l/ha), Ascra Xpro (0,8 – 1,0 l/ha), Balaya (1,2 l(ha) oder auch die Carboxamid-freie Tankmischung aus z.B. Azbany + Orius (0,7 + 0,7 l/ha). Nur bei sehr spät auftretendem Braunrostbefall ab der Roggenblüte können reine Azol-Präparate wie Folicur (1,0 l/ha) oder Panorama (0,4 l/ha) eingesetzt werden. Diese Präparate dürfen bis zum Ende der Roggenblüte (BBCH 69) zur Anwendung kommen.
Versuch Winterroggen: (Grafik 2)
Dominierende Blattkrankheiten in Winterroggen waren in 2024 Braunrost und Rhynchosporium. In einem Gemeinschaftsprogramm der LWK Niedersachsen zur Kontrolle dieser Krankheiten wurden in BBCH 39 bis 51 verschiedene Azol-Carboxamide bzw. Strobilurin-Kombinationen in ihrer Wirksamkeit auf Befall und Ertrag geprüft. Im Vergleich zur Kontrolle wurde die Blattgesundheit durch alle gesetzten Maßnahmen verbessert, wobei Elatus Era unabhängig von der Aufwandmenge die vergleichsweise höchsten Wirkungsgrade hatte. Positiv in der Wirkung fielen ebenso die Mittel Univoq und die Kombination Orius plus Elatus Plus auf.
Die Versuche belegen jedoch auch eine deutlich abfallende Feldwirkung von Revytrex gegen Braunrost. In diesen 2024 häufig vorhandenen Kurativsituationen gegen Braunrost zeigte sich Elatus Era offensichtlich leistungsstärker als Revytrex. Die Zugabe von Comet (Pyraclostrobin) zum Revytrex (Variante 10) verbesserte der Wirksamkeit auf Braunrost deutlich.
► Wintertriticale (Abb. 6)
Mehltau, Gelbrost und Braunrost sind die wichtigsten Blattkrankheiten, die in Triticale zur Ertragsabsicherung zu kontrollieren sind. Bei geringem Ausgangsbefall im Frühjahr in spät gesäter Triticale nach Mais und/oder in blattgesünderen Sorten wie z.B. Belcanto, Bicross, Tributo oder Lumaco reduzieren sich die Fungizidmaßnahmen häufig auf eine Einfachmaßnahme auf den vollständig geschobenen Blattapparat (BBCH 39 – 51). Hier bieten sich roststarke Kombinationen mit Dauerwirkung wie z.B. Elatus Era + Sympara (0,75 + 0,25 l/ha), Revytrex + Comet (1,0 + 0,33 l/ha) oder auch Univoq (1,0 - 1,2 l/ha) an. Diese Mittel können auch in Spritzfolgen als zweite Maßnahme zum Ährenschieben zum Einsatz kommen. Ein frühzeitiger Befall durch Roste im Schossen lässt sich mit Azolen wie z.B. Orius (1,0 l/ha) oder z.B. Bolt (0,5 - 0,6 l/ha) kontrollieren. Kommt zum Gelbrost noch Mehltau hinzu, ist Verben (0,5 - 0,7 l/ha) oder Forapro (0,6 – 0,8 l/ha) gut wirksam. Bei höherem Befall an Halmbrucherregern und auch Rostarten steht der Unix Pro Pack (Unix + Pecari, 0,5 + 0,5 l/ha) zur Verfügung. Effekte auf den Halmbrucherreger lassen sich allerdings nur mit hohen Aufwandmengen dieser Mittel erzielen. Versuche der LWK Niedersachsen zeigen, dass die Wirkung gegen Halmbruch grundsätzlich begrenzt ist. Einerseits durch Witterungsfaktoren und andererseits durch regional auftretende resistente Halmbruch Populationen. Letztere treten vor allem in Regionen mit langjährig intensivem Weizenanbau auf.
Beim Anbau von Triticale nach Mais in Mulchsaatbestellung kann die Situation auftreten, den Bestand gegen Ährenfusariosen absichern zu müssen. Eine entsprechende Zulassung gegen diesen Schaderreger besitzen in Triticale die Fungizide Input Classic mit 1,25 l/ha als auch Helocur mit 1,25 l/h. Aktuell besteht nun auch für das Präparat Navura eine Zulassung gegen Ährenfusarium in Triticale mit 1,5 l/ha. Bedenken Sie, dass Fungizideinsätze gegen Ährenfusariosen begrenzte Wirkungsgrade erzielen. Sinnvoller sind vorbeugende pflanzenbauliche Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Pflanzenschutzes wie das Zerkleinern von Maisstoppeln mit anschließender Pflugfurche oder auch der Anbau toleranter Sorten. Durch die Auswahl gesünderer Sorten kann die Reduktion des DON-Gehaltes im Erntegut deutlich beeinflusst werden. Triticalesorten mit guter Festigkeit gegen Ährenfusariosen sind z.B. Belcanto, Lumaco oder Bicross.
♦ Zusammenfassung:
- Gesunde Getreidesorten und angepasste Aussaattermine senken die Befallswahrscheinlichkeit für Krankheiten.
- Ein gezielter und wirtschaftlicher Fungizideinsatz ist am ehesten über regelmäßige Bestandskontrollen sicherzustellen.
- Bei frühem Befall mit Blattkrankheiten (2024) waren die T1-Fungizidmaßnahmen in anfälligen Sorten häufig wirtschaftlich.
- Die wesentlichen Schaderreger in Gerste, Roggen und Triticale sind durch die vorhandenen Wirkstoffe noch sicher zu kontrollieren.